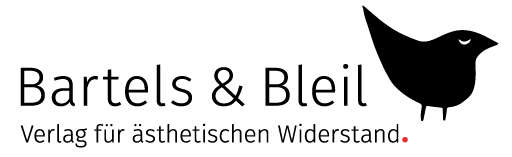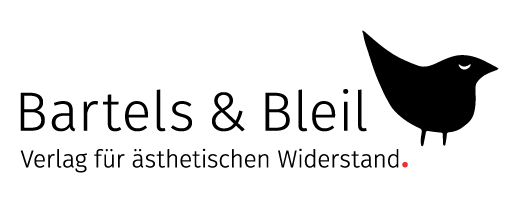Sonntage sind die traurigsten Tage, an denen man mit Kindern herbstlich-winterlich auf Berliner Spielplätzen verbringen darf und muss. Sonntagnachmittage und schmutziger Sand. Nachmittage mit unglaublicher Länge. Glasscherben findet der Kinderfuß, wenn man noch Glück hat. Benutzte Kondome oder Spritzbesteck, wenn man weniger glücklich ist. Teile davon, mit oder ohne den winzigen Partikelresten anderer Menschen, die man auf diese Weise nicht kennenlernen wollte, nimmt man samt dem unvermeidlichen Sand in den Schuhen mit nach Hause. Auf die Couch, in die Küche, ins Bett, wenn man vergessen hat, zuvor in die Notaufnahme oder die heimische Luftschleuse der Gated Community zu gehen.
Über den zum Draußensein in der Kälte und Gräue des deutschesten aller deutschen Wetter verdammten Familienmitgliedern hängt dräuend der Himmel der kalten, dunklen Jahreszeit. Die Farbe von Kruppstahl. Die Bäume haben es längst aufgeben, in die Schichten von Grau der deutschen Innenstadtarchitektur ihr mattes Grün zu tupfen. Unter den Schuhsohlen, mit denen man nicht in den Sand will, aber nonchalant darüber hinwegsieht, kleben ein paar Haufen Hundedreck. Der Sand hat eine Farbe wie man sie aus dem Inneren von Katzenklos vermutet. In der Luft hängt der Geruch von kaltem Kaffee, süßlichen Kuchenresten, eine Marihuanawolke mäandert zwischen den Nasen. Hundeurin, schales Bier sowie ein ungefährer Stuhlgeruch runden das Bukett ab. Die Trinker spielen Tischtennis, und die Nachwuchsobdachlosen wünschen sich, bei den Großen auch mal mitzuspielen. Gegröle von irgendwoher. Ab und an lässt ein Verwirrter die Hosen runter. Die Eltern mit dem Gösser in der Hand wählen unauffällig eins eins null. Acht bis dreizehn Minuten später. Die Polizei betritt den Sandplatz. Man ist ja einiges gewohnt, aber in diesem Morast zu stehen, mutet selbst den Lässigsten Berliner Straßencops zu viel zu. Verschämt tritt ein absolut altersloser Elternmensch zu den Beamten. Sehr, sehr ruhig gestikuliert er in die Richtung, in die der Mann mit der Hose um die Knöchel barärschig getorkelt sei. Paar Vierjährige bestaunen den Ausrüstungsgürtel der Uniformierten. Aus ihrer Unterperspektive müssen die Menschen mit den schuss- und messersicheren Westen und dem breiten Schriftzug über der Brust wie die Wunscheltern aussehen, die ihre überbetont lässigen Kumpeleltern in ihren ewigen Sneakern und dem Denglisch nie sein werden. Autorität. Erziehung. Flat White und Bananabread.
Der Sehnsuchtsblick auf den Endgerätebildschirm verrät wie schon vor dreißig Sekunden, noch drei Stunden bis Netflix. Den Nachwuchs fragen, was es heute zum Abendbrot geben soll. Vietnamesisch, Thai, Falafel, Sushi? Hatten wir gestern schon. Also Burger. Aber nicht wieder die veganen, die schmecken scheiße, sagt das Kind und verkündet laut genug, dass man es bei Tischtennisplatten noch hört, es muss pinkeln. Ab in die Rabatte, damit die Pflanzen etwas zu trinken kriegen. Die Pflanzen mit den traurigen Blättern, die Sträucher mit den abgeknickten Ästen, die kahlen Bäumen – ein Triptychon des Todes. Man hört sie regelrecht jubeln über so viel Wasser, die urbane Flora. Die Erde hat die Farbe von Kot, es riecht nach Ammoniak.
Inzwischen explodiert das Klima auf der anderen Seite der Erdhalbkugel. Ein Kind kommt mit einem Kronkorken in der Hand und präsentiert ihn stolz wie eine Goldmünze. Elternmenschen reden über N-A-C-H-H-A-L-T-I-G-K-E-I-T. Ein Grüner betreibt Wahlkampf. Links den Sohnemann auf dem Arm, rechts einen Flyer in der Hand. Er strahlt, der Flyer.
Die Blicke in andere Betroffenen- gleich Elterngesichter sagen, ich hätte ja mal nicht gedacht, dass ich jenseits des Zauns stehe, über den all die gut, das heißt extra nicht gut gekleideten, flanierenden Sonntagsmenschen mit kleinen Tüten und verschränkten Armen blicken, als sähen sie ins Innere einer Metzgerei kurz vorm Feiertag. Ja, richtig, sagt der traurige Elternblick, das kommt dabei raus, wenn man in der Stadt leben will und nicht wie die eigenen Eltern in der Provinz im Einfamilienhaus. Der Stadt gehört die Zukunft, oder wie es heißt es bei Marx & Engels?
Kurz nach halb sechs. Es dämmert wie seit Stunden schon. Jetzt ein Eis. Salziges Karamell mit Erdnussbutter. Mango mit bunten Streuseln, nein, Marshmallows, nein, Gummibärchen. Morgen ist Montag. Niemand weiß, was das heißt, außer, dass die Kinder heute noch in die Badewanne müssen. Während sich die Verpackungsreste der FalefelBurgerIndisch-Mahlzeit von der Küche in den Flur türmen – das riecht immer so unschön, wenn man mit essen fertig ist, igitti – läuft das Wasser in die Wanne. Die Waschmaschine wechselt in den Schleudergang. Die Spülmaschine beginnt die Spätschicht, das zuverlässige Ding, wie bin ich froh über die Anschaffung. Automatenliebe. Das Kind / die Kinder blicken in die Endgeräte. Im indirekten Halblicht der Wohnzimmerbeleuchtung zeichnen sich auf ihren aschfahlen Gesichtchen die bläulichen Widerscheine ihrer Lieblingsserie ab. Gleich erfolgt der Wutanfall, sie durften auch nur anderthalb Stunden gucken.
In der Badewanne ist verhältnismäßig etwas mehr Wasser als Schleichtiere, Lego, Töpfe, Löffel, Fillypferde drin sind. Man schwitzt mit hochgekrempelten Ärmeln in einer anatomisch unmöglichen Position – Gesäß über Kopf –, tief gebeugt über den Wannenrand, vergeblich versuchend, die letzten Shampooreste aus den Kinderhaaren zu spülen. Von den gekachelten Wänden im engen Nassraum halt das Kindergeschrei drei-, viermal zurück, bevor es auf die elterlichen Trommelfelle trifft, wie ein Schlagbohrer auf eine Rigipswand. Der Blick aufs Endgerät verheißt, noch fünfundvierzig Minuten bis Netflix. Aufräumen tu’ ich morgen. Nach überstandener Hygienemaßnahme hinterlässt das abfließende Wasser ein Konglomerat aus viel zu kleinem Spielzeug und viel zu großem Küchenutensil. In der Wanne bleibt ein bisschen Sand zurück.