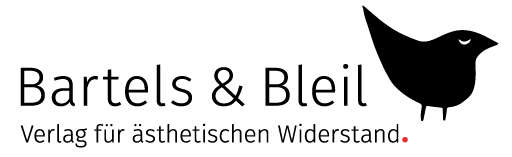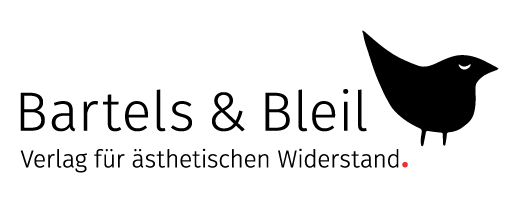Die Documenta 15 ist am 25. September 2022 zu Ende gegangen. Nach 100 Tage endeten damit auch die Diskussionen, ob man antisemitische Darstellungen von Künstlerinnen und Künstlern zeigen darf, sollte oder nicht. Die Welle der Empörung ist längst und mal wieder ausgerollt. Man könnte jetzt gesamtgesellschaftlich einfach mal abwarten, bis der nächste Skandal kommt, bei dem öffentlich gemachter Antisemitismus und Israelhass wieder bagatellisiert, ignoriert oder als egal empfunden wird.
Oder aber, ich fordere an dieser Stelle vehement und in diesen wilden Zeiten unaufgeregt, Kunst nachhaltig abzuschaffen. Generell und für alle. Einfach weg. Nicht weil Menschen durch Kunst marginalisiert oder diskriminiert werden (könnten), sondern um Kunst zu entpolitisieren. Um das Knäuel aus Intentionen, Verantwortung und Produktion zu entwirren. Um einen Punkt null zu setzen, von dem erst wieder produziert werden kann. Um Raum zu geben, um Kunst um der Kunst willen zu machen, wie es schon einmal auf irgendwelchen Fahnen stand oder nicht, und sich zu fragen, warum rede ich, wenn ich doch nichts zu sagen habe. Und um dann nüchtern über den Konnex des Künstlerischen und Politischen neu nachzudenken, wie es notwendige Voraussetzung von kritischem Denken sein sollte.
„Kunst“ „neu“ „denken“
Zensurbefürchter und Mahner an die „Freiheit der Kunst“ fürchteten schon, da wurden die letzten Stücke der Künstlerinnen und Künstler auf der Documenta 15 aus dem „globalen Süden“ wieder eingepackt, die nächste Kunstgroßveranstaltung im Maßstab der Documenta werde nicht ohne vorherige „Gesinnungs- und Unbedenklichkeitsprüfungen“ der Ausstellenden auskommen. Als ginge es darum, festzustellen, was gute Kunst und was schlechte Kunst sei. Und nicht darum, innerhalb eines Kunstrahmens Kunstprodukte zu zeigen, in denen, wie in Kassel geschehen, Juden als Imperialisten und Mörder in Uniform dargestellt werden – unkommentiert, kontextlos.
Anders als es die Öffentlichkeitshysterie bei allem, was als Tabu markiert ist, statt sich den Phänomenen dahinter mit der nötigen Übersicht und Ruhe zu widmen, befürchten lässt, liegt die Ursache des Skandals keineswegs außerhalb des Handlungsbereichs der Verantwortlichen. Was passierte, geschah nicht zufällig. Die Ausgangslage ist in der Tat überschaubar. Auf der einen Seite stehen die Kunstschaffenden. Auf der anderen Seite die Kunstbürokraten, die Räume und Finanzmittel bereitstellen, in denen und mit denen Erstere wirken können. Im Fall der Documenta 15 wurden Kunstschaffende zugleich mit kuratorischen Aufgaben betraut. Sie waren etwa befugt, andere
Kunstschaffende einzuladen. Binnen kurzer Zeit geriet aus dem Fokus, wer eigentlich was machte und warum.
In Anbetracht der eigenen Ahnungslosigkeit der Verantwortlichen, die doch gescheite Leute sein müssen – oder wie kommen sie sonst in solche Positionen? –, lässt sich nur von einer ausgestellten Dummheit sprechen, mit der man es zu tun hat. Das darf nicht als Entschuldigung gelten. Es ist denn auch anzunehmen, dass die publikumswirksame Dummheit bewusst inszeniert wird. Und das ist, was heftig unterschätzt wird, die eigentliche Gefahr in einem Land, dass zu Recht den Geist der Geschichte fürchtet. Dass eine solche Ahnungslosigkeit, real oder gestellt, der Nenner ist, auf den sich Kulturkreise und -schaffende nach Belieben berufen können, ist nicht mehr verwunderlich. Ein kurzer Aufreger, der mal wieder als akute Geschichtsvergessenheit auf einem Podium quasi-belächelt wird, bevor nach beflissentlichen halben Bußegesten zum nächsten Punkt auf der Agenda übergegangen wird – woraus auch immer diese sich dann zusammensetzt, fragt man sich, wenn es nicht gerade das ist, was gerade geleugnet wird. Dass das nicht die eigentliche Empörung ist, ist erstaunlich.
Es entsteht der Eindruck, es sei eine opportunistische Blase subventionsabhängiger Kunstegos auf der Seite der Kulturbürokratie wie der Seite der Kulturschaffenden am Werk. Portfoliodenker, die mit Namen und Erzählungen jonglieren und darüber jeden Zweifel auszublenden wissen. Abermals ist festzustellen: der notwendige Diskurs bleibt aus. Das Politische, das sich nicht mehr ausklammern lässt, wird solange verdrängt, bis es einem im Nacken hockt. Der Geist der Geschichte bleibt lebendig, auf die eine wie auf die andere Weise. Da dieser als das Vermächtnis, wenn man so will, so oder so unattraktiv ist, ist es nicht im Interesse der Öffentlichkeit und den Repräsentationsstrategien, diese zu inszenieren. Diesen Geist der Geschichte lebendig zu halten, ist möglich, ohne sich als Geschichtsopfer zu präsentieren und Täterschaft zu leugnen, wie es das rechtskonservative Denken gern in demagogischer Manier darzustellen weiß.
Was mit dem längst wieder vergessenen Skandal des Kunstjahres 2022 ebenfalls verschwunden zu sein scheint, ist die Tatsache, dass im subventionierten Raum der Öffentlichkeit kaum awareness gegenüber der eigenen Verantwortlichkeit gegen dem Vergangenheitserbe vorhanden ist. Schon lange vor der Eröffnung war die Empörung groß und nachdem die Politik ihre üblichen Bedenkensreden gehalten hatte, bestand noch lange nach Eröffnung die Möglichkeit nicht, dem zu widersprechen, was dort gezeigt wurde. Später gab es paar Hinweise in Form von Schildchen, die über diesen oder jenen Zusammenhang informierten. Ein Beipackzettel, wie die „Kunst“ zu „konsumieren“ sei. Das lässt sich nicht mal mehr als Schadensbegrenzung bezeichnen, es ist – und nicht erst im Nachhinein – ein Ausweis von genereller Unlust, Themen wie Antisemitismus und Menschenhass in der Kunst überhaupt aufs Tapet zu bringen.
Es ist kein Geheimnis, aber eine Strategie, sich dem Diskurs zu verweigern, wie es die Verantwortlichen der Documenta 15 auf künstlerischer wie kaufmännischer Seite lange taten. Klar ist, wer den Diskurs meidet, befindet sich in der bequemen Lage, Vorwürfe zu erheben, ohne jemandem ins Gesicht schauen zu müssen. Das Kollektiv Ruangrupa – in die Position der Kunstschaffenden wie Kuratierenden versetzt und damit auch in der Verantwortungsrolle – warf u. a. einer Gruppe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Rassismus vor. Diese hatten festgestellt, dass die Filme, die jenes Kollektiv und andere zeigen ließen, den Nahostkonflikt aus allein palästinensischer Sicht darstellten. Einseitig und als bloße Opferinszenierung. Anstatt darüber zu sprechen, duckten sich diese Künstler hinter den Verantwortlichen weg, die sie zum Teil selbst waren.
Der schnelle Rassismusvorwurf des Künstlerkollektivs untergrub den Versuch zur Kritik. Es blieb abermals das bloße Empörtsein, was stets zu einer Umkehrung der Tatsachen führt. In der Folge wurde Sachlichkeit unmöglich, die Debatte emotionalisiert und diejenigen, die aus Ahnungslosigkeit handelten, stellten sich blind, taub und stumm. Am Ende wurde nicht mehr erreicht, als dass zur Empörung vor der Eröffnung die Empörung nach der Eröffnung der Documenta dazukam.
Als sei das nicht genug, meinten die Fürsprecherinnen und Fürsprecher der künstlerischen Documenta-Leitung noch im Nachhinein apologetisch dafür argumentierten zu müssen, die nunmehr doppelte Empörung der Öffentlichkeit sei ungerechtfertigt, da wohl der „antiautoritäre Ansatz“ des Kollektivs Ruangrupa nicht verstanden wurde. Dieses nämlich „denke Kunst neu“, indem Kunst vorbei an üblichen hierarchischen Strukturen und den kunstmarktbestimmenden Mechanismen (Angebot und Nachfrage für und der Vermögenden) präsentiert werde. Als ob das Publikum nur zu blöde sei, die Gesamtdimension zu verstehen, die freilich vollkommen fehlt, weil sie von den Initiatoren, den Verantwortlichen und den Kunstschaffenden gar nicht eingenommen werden will. Die Gesamtdimension bzw. die hidden agenda – und das nur am Rande – kann sich, da ein echter Austausch nicht zu interessieren scheint, also nur daran liegen, die Kunst des „globalen Südens“ in den Kunstmarkt des Westens einzuführen bzw. mit der Documenta eine internationale Plattform zu bieten, auf der die Einkäufer und Repräsentanten von Galerien etc. den neuesten vermarktungsfähigen Trends auf der Spur sind.
Das Perfide an dieser Inszenierung ist die Scheinheiligkeit, die überall unter dem Kunstanstrich hervorsticht. Über der Documenta 15 wurde von Beginn an stolz der Banner eines sogenannten ‚antiimperalistischen Ansatzes‘ gehängt als die Perspektive von Kunstschaffenden des globalen Südens, was eine mehrfache Verallgemeinerung ist. Als wäre der gesamte globale Süden darauf aus, eine Art Antikunst wider die „westliche Kunst“ zu machen und sei daher von vornherein die bessere, da moralisch überlegene. Auf der sicheren Seite der Geschichte sozusagen. Die, die sich der Kolonialismusthematik annehme usw.
Warum nun aber bei all dem die notwendigen Antisemitismusdiskussionen auszuschließen seien, wurde nicht klar – ob im „globalen Süden“ oder im westlichen Norden. Auch wurde nicht klar, wie die Initiatoren dieser Idee darauf kamen, mit der Verantwortungsabgabe von künstlerischen Entscheidungsprozessen an dieses oder jenes Künstlerkollektiv sich der Kolonialismusproblematik zu entledigen, als könnte qua Herkunft der Kunstschaffenden jedes Gespräch und jede Kritik vermieden werden. Und als würde damit die Hierarchie des Kunstbetriebs und das noch immer greifende Genieparadigma der westlichen Kunst überwunden werden, nur weil das behauptet wird.
Kunst und Kolonialismus
Über Kunst zu sprechen, schließt zwangsweilig die Notwendigkeit mit ein, sie zu definieren, wenigstens auf einen Begriff zu kriegen. Wie so vieles, das eher im Vagen und Abstrakten zu verorten ist, um die unbestimmte Freiheit der Sache zu wahren, lässt sich ‚der Kunst‘ über die Phänomenologie nähern, ohne allzu großen Schaden anzurichten.
Der Versuch der Kunst, das komplexe zeitgleiche Gegenwärtige mit ihren Mitteln darzustellen und kommensurabel zu machen, setzt voraus, das Gegenwärtige als ein Abgeschlossenes zu behandeln. Was mit kuratorischen Auswahlprozessen und Entscheidungen, was gezeigt werden soll und was nicht, einhergeht. Mit anderen Worten, man befasst sich nicht mit der Gegenwart als dem Jetzt des Geschehens, sondern als einem Vergangenen – sonst erübrigte sich die Frage nach der Perspektive auf dieses nicht fassbare Gegenwärtige und damit der Kunstrahmen überhaupt.
Was hinter den Kunstbegriffen jedoch nicht verhandelt wird, ist die Problematik der Themenaktualität, die die Kunst eigentlich erklären sollte. Wird Kolonialismus zum Banner als umfassendes Thema, geht man davon aus, dass der Prozess der Kolonialisierung abgeschlossen ist. Die Idee der Documenta 15 wurde es so, Kolonialismus als ein Problem des 19. und 20. Jahrhundert zu betrachten, nicht als ein gegenwärtiges. Das ist maximal befremdlich. Weltweit werden nach wie vor Land und Leute von den Industriestaaten des Westens ausgebeutet, auf staatlicher und privater Ebene. Auch wenn keine Hände mehr abgeschlagen werden wie in Belgisch-Kongo damals, sondern die Hände der Armen „nur“ gebunden, um Kobalt und andere Ressourcen aus der afrikanischen und asiatischen Erde zu kratzen. Für den Batteriebedarf von Smartphones, Elektroautos und Vibratoren (in dieser Reihenfolge).
Ob das Thema ‚Kolonialismus‘ auf die eine oder andere Weise im Kunstrahmen praktisch umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Mir geht es aber darum festzustellen, dass sich im öffentlichen Raum der Illusion hingegeben wird, man sei heute mit dem Thema Kolonialismus durch. Es ist weder erledigt und eine Auseinandersetzung findet bis heute nicht angemessen, z. B. im Geschichtsunterricht an Schulen oder an der Universität, statt. Am Ende der (bildungs-)politischen Debatte in der „aufgeklärten Gesellschaft“ wird in der Folge bequemerweise alles Weitere der Kunst überlassen. Das ist fataler als es zunächst klingt. Denn zu behaupten, man könne mit Kunst Welt verstehen, ist so, als behauptete man, mit dem Messer in der Hand dem Tier nachzuempfinden, das mit eben diesem Messer geschlachtet wird. Es ist der Weg der Dummheit, Sachverhalte ihre Komplexität abzusprechen und ‚Welt‘ einfacher darzustellen als sie ist.
Was geschehen war, ist, dass der Prozess der Kunst von der Documenta-15-Leitung in die Sprache der „Businesswelt“ als Outsourcing verstanden wurde, um die Diskurse, denen man sich öffentlich in einem demokratischen System stellen sollte, in den Kunstbereich abzuschieben. Aus dem kann man, wie dargestellt, Gespräche zulassen oder eben verweigern. Wenn es drauf ankommt, beruft man sich auf die eigene Ahnungslosigkeit – tut mal wieder so, als wüsste man etwa nicht, dass Antisemitismus ein „ernstes Thema“ sei. Was eigentlich auf der politischen Agenda zu stehen hat, wird zum Kunstthema umgemünzt und der Künstler steht da – allein gelassen mit der Verantwortung, ja das Richtige (im politischen Sinne, der unklar ist) zu tun und die der Diskurs mit sich bringt, also ihm aufbürdet, während die Politik schweigt. Und da man als westliches Land Menschen aus dem „globalen Süden“ diese Kunst machen und zeigen lässt, entzieht man sich auf politischer Ebene dem Vorwurf, die Perspektive des „globalen Südens“ nicht gelten zu lassen. Das gute Gewissen, das „Richtige“ getan zu haben, macht sich mal wieder in der selbst beruhigten Gesellschaft der Kulturbürokraten breit.
Es scheint auch bequemer zu sein, anstatt die heute als falsch erkannten Ansätze der letzten 200 Jahre der kulturellen Aneignung und Raubkunst weiterhin öffentlich zu wälzen, den sogenannten ‚Provenienzansatz‘ in einer praktischen Volte zum Prinzip der Kunst selbst zu erheben: Man kauft sich die bisher Marginalisierten als Kunstproduzenten einfach ein, statt mit ihnen zu sprechen. So – die Logik dieser Denke – kann niemand behaupten, man grenze „Perspektiven“ oder gar „Menschen“ aus. Das sieht nach der öffentlichkeitswirksamen Behauptung in der Umsetzung dann so aus, dass sich um die Raubkunst in den Berliner Museen im Hohenzollern-Retrostil für die nächsten paar Hundert Jahre zwei bis drei Kunstforscher kümmern.
Dass paar Indonesier aus irgendwelchen historischen Gründen antisemitische Ikonografie nutzen (was seinen Ursprung angeblich in der indonesischen Freiheitsbewegung der 1990er-Jahre hat), um dem Westen und damit auch Israel seine Amoralität und generelle Scheißigkeit vorzuwerfen (das politische Unterdrückerregime der damaligen Zeit zu unterstützen), heißt ja nicht, dass diese Künstler Nazis sind, oder doch? Wozu also die Aufregung. Mit Nazis kennen wir uns doch aus, hier in Deutschland –
Kunst kommt von Kosten
Kunst – als die allgemeine vermarktungsfähige – wurde spätestens seit den 1990er-Jahre zur Ware wie andere Produkte im gottgesegneten Kapitalismus auch, und damit zum Interesse der Vermögenden. Als Künstlerin und Künstler arbeitete man besser nicht nur im Atelier, sondern auch am eigenen Auftritt im öffentlichen Raum. Lavieren, wusste Brecht, ist das Wichtigste. In dieser Konsequenz reifte die Künstlerpersönlichkeit zum Popstar. Exklusivität und Einmaligkeit machten Leute wie Basquiat, Banksy, Damien Hirst, Jeff Koons, Tracey Emin usw. zu Ikonen einer nabelschauenden Kunstwelt, in der – ob tot oder lebendig – der Ruhm des Künstlers über dem seines Werkes stand und erst recht heute steht. Vermögende ließen und lassen sie es sich gern etwas kosten, um an der künstlerischen Aura, wenn auch nur materiell, teilzuhaben oder besser: davon Besitz zu ergreifen. In dieser Atmosphäre der Kunsteuphorie, die in den Galerien und Auktionshäusern herrscht, wird verkunstet, was Künstler anscheinend am besten verkaufen: ihr eigenes geiles Leben, das die biederen Kunstsammler Schrägstrich Vermögenden als exzessiv hinter vorgehaltener Hand ehrfürchtig anerkennen, um so die Exzeptionalität ihres Wertobjekts anzupreisen – im Kreise anderer Vermögender. Der Künstler wird mit der Kunst zusammengedacht und je wilder beide in der öffentlichen Wahrnehmung und der vor allem Vermögenden erscheinen, desto profitabler sind sie, desto höher steigt ihr Wert auf dem sogenannten Kunstmarkt. Alter Hut. Auch, das maximale Persönlichkeitsausschlachtung (Tracey Emin) und öffentliche Abstinenz (Banksy) im Grunde dasselbe sind, nämlich die Ausstellung und Selbstoffenbarung der eigenen Mittelmäßigkeit als Kompensation und Sublimierung im Kitsch (Paradebeispiel: Jeff Koons), die mit der Künstlerfigur verschweißt ist.
Dazu kommt, wenn man als westlicher Künstler nicht zumindest irgendeine soziale Macke oder Phobie vorzuweisen hat, braucht man gar nicht erst anzutreten. Dagegen reicht bei den Künstlern des „globalen Südens“ bereits die Herkunft aus, um jemand zu sein. Armut, Unterdrückung und politischer Widerstand werden zu den Profitabilitätsgaranten auf der Suche nach neuen Trends und unverbrauchter Sexyness der Kunstschaffenden. Das Bild vom unterdrückten, psychisch labilen Künstler, der sich gegen „das System“ stellt, gefällt im Westen natürlich besonders. All die kleinen großen „Genies“ (die nur von anderen, kleinen Leuten als solche bezeichnet wurden/werden) – von Byron bis Warhol – feiert man schließlich immer noch, wenn auch bisschen mehr im Stillen als öffentlich, weil weiße, mehrfach privilegierte Männer und so. Und wenn man genau hinhört – nicht auf die Zwischentöne, sondern auf das aufgeregte, halb unterdrückte Geraune aus den Ecken hört man die Hoffnungen der deutschen bürgerlichen Spießerseele, wie sie sinnbildlich nach Süden schaut – wo auch immer das also ist: Aber meinen Goethe lasse ich mir nicht nehmen … und dekantiert schon mal den nächsten Wein.
Kunst und Kotze
Warum Kunst, wie die Documenta 15 meinte, „neu denken“, wenn man sie doch besser abschaffen und damit den Künstler gleich mit, um ihn als das zu sehen, was er aus Sicht des Marktes seit Jahrzehnten ist? Wäre das nicht einfacher, als sich den Zumutungen einer überkomplexen erscheinenden (Kunst-)welt immer wieder neu zu stellen? Lieber Marken schaffen, die produziert wie Hühner Eier legen. Man sparte sich damit die lästigen Diskussionen und ewigen Begriffsbestimmungsversuche, welche Menschen, welche Religion, welche sogenannte Minderheiten denn jetzt schon wieder missachtet, abgewertet, unterdrückt werden. Warum über die Schere im Kopf und am Planungstisch nachdenken, wenn man sich das ganze Tohuwabohu sparen könnte und ganz einfach auf lästige „Menschliche“ dabei verzichten könnte? Vielleicht paar KI-Avatare anstelle dieser sogenannten Menschen setzen. Ist definitiv billiger, gibt keine Widerworte, außer man ist so blöd und programmiert sie mit ein. Ist vielleicht bisschen unsexy am Anfang, aber alles Gewöhnungs- und Geschmackssache. Wie Kunst selbst.
Ich frage mich, welchen Anspruch verfolgt die Kunst des Westens, außer ihre Westlichkeit dem westlichen Publikum zu spiegeln, das gähnend alles abnickt, was seinem dekadenten, die Welt zerstörenden Lebensstil mal wieder bejaht oder durch den Kakao zieht. Warum so tun, als hätte Kunst tatsächlich relevant und warum sie wie einen Schild vor sich hertragen als „unsere“ Kultur, wenn diese Kultur doch offensichtlich wie alles andere in der westlichen Gesellschaft nur von Geld und Macht bestimmt ist – inhaltlich wie kuratorisch – und damit ganz bestimmten Zwecken dient. Also dem Aufpolieren des eigenen Egos oder Prestige. Nach Luxusvilla, Edelkarosse, Rassepferd und Jacht bleibt für den halbwegs öffentlichkeitsgeilen Vermögenden doch nur die Kunstsoße, die andere für „gut“ gleich als profitables Anlageobjekt erkannt haben (und dafür ordentlich kassieren). Und für die „Kunst des globalen Südens“ lässt sich doch auch nur feststellen: Ob Westen oder Süden, Arschlöcher gibt es überall.
Bilder auf Mauern oder „demokratische Kunst“
Es nutzt dann auch der niedliche Versuch der Street Art und anderer „demokratischer“ Kunstströmungen nichts bis überhaupt nichts, Kunst auf die Straße zu bringen oder „im Kleinen“ zu fördern, in den Alltag zu bringen oder was auch immer für Halbargumente dahinterstehen, den öffentlichen Raum mit irgendeiner Buntmacherei zu verhübschen. Auf der Straße freut sich der durchschnittliche Arbeitssklave am subventionierten Geprange an den grauen Hauswänden, die den Horizont seines Wohlstandselends bilden. Eine schöne Wahnvorstellung. Was die Werbeindustrie längst erkannt hat. Es ist nicht mehr klar, ob die beklebte Hauswand am Kotti oder in einem ukrainische Kriegsgebiet Kunst ist oder Werbung oder das Abfeiern irgendeiner ikonografischen Selbstdarstellung.
Ich fordere daher aus der Unbedingtheit eines lebendigen Geistes der Geschichte: weg mit allem, was „schön“ zu sein hat – solange Schönheit an einen materiellen Gegenwert gekoppelt ist. Und wenn die Vernunft gleich am Werk ist, gleich alles weg, was unter diesem Begriff subsumiert wird: Malerei, Bildende Kunst, Film, Theater, Tanz und allem voran die fließbandproduzierten Gegenwartsromane aus den Schreibschulschmieden mit ihrer Scheißdepression, Persönlichkeitsstörung und Identitätskrise usw. Alles, was ohne Herz entsteht, geboren nur aus einem möglichen Marktinteresse, aus dem Ungeist und Umfeld der sozialen Medien, in denen Relavanz an vergebenen und gesammeltem Herzchen gemessen wird. Aus diesem Trendismus Kunst machen zu wollen, ist der übliche Versuch des Kapitals, sich am vermuteten Geschmack der wahlweise Masse oder „der“ Jugend zu orientieren, um an ihnen zu verdienen.
Und überall, wo der Verstand regiert, der stets auf die Optimierung der Verhältnisse zielt, liegt der Fokus auf der Oberfläche, die glatt sein muss, um zu scheinen und dem Gesetz der Effizienz zu gehorchen. So wie in der Architektur alles Schmückende oder Verschönernde zum Zierrat herabgesetzt wird, der vor allem Geld kostet also ineffizient ist, und das Gesicht der Stadt sich mehr und mehr in eine maskenhafte Erscheinung verwandelt. Konturlos, unterschiedslos, emotionslos. Am Reißbrett verordnete Schönheit aus Flächen, Ecken, Kanten, nichts weiter.
Utopische Gegenwart
Warum die Aufregung? Ist es nicht exakt das, was der aristokratische Oberphilosoph und Säulenheilige des Westens, der große Platon, für seinen utopischen Staat gefordert hat, in man nicht mehr brauchen sollte, als nur genug zu essen und regelmäßig bisschen Krieg zu führen? Vorstellungen, die zu Blaupausen jeder Form von Totalitarismus und Willkür der Mächtigen weltweit führten, die diesem „Spaß“ vorstehen, seit Platon und seine Spießgesellen so hart nachdachten – den ganze lieben Tag lang unter der attischen Sonne –, dass sie die Sklaven vielleicht gar nicht mehr bemerkten, die den Wein nachschenkten. In der ersten Demokratie auf diesem tollen Planeten. Für Platon galt höchstens die erbauliche Kunst etwas, die einen nicht zu sehr aufregt und das Tugendhafte bestätigen sollte. Alles Niedere, also alles, was zum Nachdenken anregt und „Gefühle“ anspricht, sollte weg. So auch ihre Produzenten: die Dichter. Seit zweieinhalbtausend Jahre lebt der westliche Mensch nun schon in dieser Wirklichkeit gewordenen Utopie. Die neueste Ausformung sind die selbst gewählten digitalen Blasen eigens kreierten politischen Komfortzonen, aus denen sich leicht alles anzweifeln und wegignorieren lässt, was so in der „Welt“ passiert und einem nicht passt. Klimawandel, Energiekrise, emanzipierte Frauen? Weg damit. Platons Utopie ist Wirklichkeit geworden, sie ist zur Gegenwart geronnen. Zum heimlichen Ordnungskonzept, in der jeder in seinem persönlichen Paradiesgefängnis sitzt. (Die so wichtige Frage nach der „Gerechtigkeit“ im Staat stellt sich nicht mehr, denn es gibt sie nicht, die Gerechtigkeit. Es gibt auch keinen, der fragt.)
Lachen und Liebe sollten übrigens auch gleich verboten werden. Weil: mehr als Lustigseintabletten vom Psychiater und Konsum (Rausch und Entertainment) braucht kein anständiger (im Goebbelschen Sinne) Mensch dieser unserer westlichen kapitalistischen Utopie, in der wir nichts weiter zu tun brauchen, als Gehorsam zu leisten. Alles andere würde nur kritisches Denken fördern, dem Projekt der Aufklärung Vorschub leisten und an das Rühren, was Menschen besitzen, bevor sie erwachsen werden: das Herz.
Birth, School, Work, Death. Nicht vergessen: Consume. So wie es eben läuft, jeden Tag, bis zum Untergang wider das lästige Nachdenken über das sogenannte ‚Menschsein‘.
—
Der Text nutzt u. a. diese Quellen, geprüft September 2023:
Der Documenta Skandal – Reportage & Dokumentation – ARD | Das Erste (https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/der-documenta-skandal-100.html)
Bilanz der Documenta 15 – Trotz des Skandals ein gutes Konzept | deutschlandfunkkultur.de (https://www.deutschlandfunkkultur.de/documenta-15-fazit-100.html)
Wolf Lepenies, Melancholie und Gesellschaft (1969)
John Carpenter, They Live (1988)
The Godfathers, Birth, School, Work, Death (1988)
Axel Hacke, Über den Anstand in schwierigen Zeiten (2017)