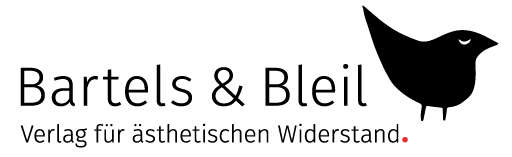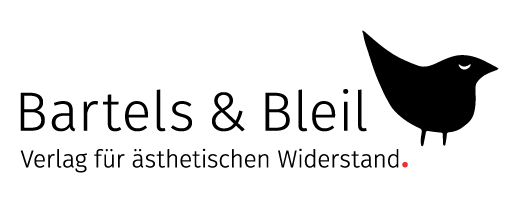In Zeiten der geschlechtergerechten Sprache zeigen sich in der westlichen Kultur zwei Diskurswege: der sprachkritische und der performative. Beide sind beschaffen wie ein Panzerweg im Wald. Schwer zu gehen, aber irgendwie hübsch anzusehen.
Der sprachkritische Weg führte aus einigen Uniseminaren bis in die politischen Sphären. Wie man hört, werden die Diskussionen dort mitunter mit dem Messer zwischen den Zähnen geführt. Zugleich sieht man älteren Herren, vornehmlich konservativen Politikern – beklatscht von den üblichen Polemikhälsen aus der rechten Jubelecke –, in der Öffentlichkeit dabei zu, wie sie großmütig als Gewäsch abtun, was der progressive Weltgeist als fundamentalen Wandel von Sprache und Kultur fordert. Die Diskussionen um die „korrekte“ Sprache führt bisweilen zu einer Grabenmentalität und die Debatte wird durch Geschütze wie Pejorativen und Sarkasmus befeuert.
Der zweite, performative Weg ist halbaufgeklärten Kulturinteressierten per se aufgrund seines Unterhaltungswertes suspekt. Es ist der Weg der US-amerikanischen Mainstreamfilmkultur als der bestimmenden Kultur der westlichen Welt. Hollywoods Zensurpolitik wird seit je von den moralischen Schwingungen der doppelzüngigen Klemmi-Kultur der USA bestimmt. Das heißt heute: zerplatzende Schädel und Hektoliter Blut okay, aber eine entblößte Brustwarze und das Land steht an der Schwelle zum Bürgerkrieg. In Deutschland ist das umgekehrt, oder?
Vielleicht auch „d“
Der sprachkritische Weg ist das Ergebnis der politisch gewollten Gleichberechtigung von Mann und Frau im Medium Sprache. Später, vielleicht (aber wirklich nur vielleicht), werden auch Menschen nicht binärer Identitäten integriert, die man abgesehen von vielfältigen Identitätsmöglichkeiten (LGBTQI+) noch offiziell der Einfachheit halber als „d“ bezeichnet, als „divers“. „Divers“ wie in „diese Mischung enthält diverse Gewürze“ oder „die Spree fließen diverse Mengen Wasser hinunter“.
Grundsätzlich lautet die Idee oder der Wunsch oder die Forderung, dass die Gleichberechtigung im offiziellen Sprachgebrauch sowie im Alltag stattfinden soll. Praktisch sieht das so aus, dass Sternchen, Suffixe, Gaps mal vorgeschlagen und mal bekrittelt werden. Das übliche Surfen auf der Oberfläche also, statt die Gelegenheit zu nutzen, um über grundlegende, verfahrene Verhaltensweisen, Gesellschaftsmuster und damit ein Grundverständnis unseres Zusammenlebens in einer aufgeklärten, selbstbewussten Gesellschaft im öffentlichen wie im privaten Raum nachzudenken. Denn was an der Oberfläche schwimmt, wird für das einzig Vorhandene genommen (weil es sichtbar ist) und so fürchten viele um die heilige Kuh der deutschen Sprache: das Kompositum. Wortkreationen à la allemand wie Bürgermeisterwahl, Wählerverzeichnis und Bürgerkrieg und andere schöne substantivische Zusammensetzungen, die allesamt auf der Verwendung des sogenannten generischen Maskulinums beruhen. Welch Verlust das wäre für die deutsche Sprache, von der konservative Kräfte ausgehen, als wäre sie ein Fels, der ewig steht, statt sie als das anzusehen, was sie immer schon war: ein offenes, dynamisches System, aufnahmefähig für andere Sprachen und Einflüsse.
Frauen sind Männer sind Dings sind Frauen
Der performative Weg drückt sich in genretypischen Rollenmustern aus, deren Protagonistinnen und Protagonisten der US-amerikanischen Filmkultur entschlüpfen. Nach dem die Altherrenriege der Genrehelden aus den 90er-Jahren wieder unter den Lebenden weilen muss (Bruce Willis, Liam Neeson und Co.), lebt nun auch wieder der Typus der Genreheldin auf. Ich nenne sie die Siegfriedin. Sie heißen Lucy, Anna, Kate und geben zugleich den Filmen ihren Titel. Hier sehen wir die Frau als Killerin, die wie ihre männlichen Genreverwandten, als die Guten gegen das Böse antreten. Sie handeln in eigener Sache (Rache) oder im Auftrag anderer (ominöser Geheimdienste) und ihr Handwerk zeichnet sich dadurch aus, uniform gekleidete (vor allem männliche) Gegner genüsslich, grafisch detailliert, akrobatisch sowie zynisch (Oneliner, überlegene Blicke) im Medium Film zu töten. Blut fließt, Knochen brechen und so weiter. Häufig tragen die Feinde Masken, die ihnen das Individuelle nehmen, und ihre Bewegungen wirken marionettenhaft choreografiert. Notwendig sind sie, da Schauwerte generierend (explodierende Köpfe und so).
Noch mal zu den männlichen Genrehelden. Sie sind allgemein körperlich überlegen, aber auch ein bisschen dumm. Genau wie der Siegfried in der Nibelungensage. Im Film heißen sie John Wick, Bryan (Taken), Robert McCall (Equalizer) Frank (Transporter), Jason Bourne, Duncan (Polar), Hutch (Nobody), Roy (Boss Level), um nur einige der hochwertigeren Produktionen zu nennen. Sie werden von den Schatten ihres früheren Killerdaseins heimgesucht (der Ruf hängt ihnen nach wie Siegfried der Beiname Drachentöter) oder sie wollen aus ihrem Beruf (das Töten) aussteigen (Siegfried will sich nach seinen Abenteuern, Söldnerdienst etc. mit Krimhild auch nur zur Ruhe setzen). Diese Entscheidung macht sie zum Paria, denn sie sind der Wahrer des Geheimnisses. Lebendig und frei stellen sie eine Gefahr für die Hegemonie der Macht dar – lassen sie sich jedoch nicht kontrollieren, müssen sie getötet werden. Der Mannheld als One Man Army stemmt sich gegen die Ungerechtigkeit, die immer vom oberen Ende des Machtgefüges ausgeht. Aber, er handelt nicht altruistisch, sondern allein um des eigenen Wohls wegen, denn er will doch nichts weiter als seine wohlverdiente Ruhe. Nur lässt sich diese nicht anders herbeiführen als durch körperliche Gewalt – durch Ausschalten des Machtsystems, das ihn zu beherrschen sucht. Das Töten wiederum bedarf keiner Rechtfertigung, denn was will man von einem Killer anderes erwarten, als seiner Profession nachzugehen.
Weibliches Pendant und Wiedergängerin
Lucy et al. sind aber nicht nur Pendants zu männlichen Vorbildern. Sie sind zugleich Wiedergängerinnen früherer Vorbilder wie Barbarella, Ripley (Alien), Nikita, Rebecca (Tank Girl), Barbara (Barbe Wire), Buffy, Selene (Underworld). Ein Frauentypus des Genrefilms, der sich alle zehn Jahre mit dem der Scream Queen abwechselt – ihr ohnmächtiges Gegenbild. Die klassische Psychoanalyse nannte diese Frauen Hysterikerinnen. Jene aber, die Siegfriedin, spiegelt männliche Eigenschaften wider. Im Film verfügt sie über ähnliche Fähigkeiten: Martial Arts, Nahkampf, Gebrauch von Hieb-, Stich- und Schusswaffen. Und, sie ist zumeist ebenso wie der Genreheld attraktiv und eindeutig heteronormativer Prägung und Neigung.
Die Siegfriedin jedoch ist die androgyne Verkörperung des Sexuellen beider Geschlechter. Prototypin aller Wiedergängerinnen ist Ellen Louise Ripley (Alien). Eine Frau, deren Physiognomie der eines Mannes gleicht und zugleich genuin feminin wirkt. Zu den Legenden von Alien gehört, dass Regisseur Ridley Scott darauf bestand, die Figur Ripley statt mit einem Mann mit einer Frau zu besetzen. Die Lust des männlichen Publikums an der Zerstörung des Weiblichen (die Prämisse des Slasherfilms) und zugleich die unbewussten männlichen Ängste vor Penetration, ungewollter Schwangerschaft, Vergewaltigung, Ohnmacht (die Prämisse des Horrorfilms) – das sind gespiegelte (angenommene) weibliche Ängste aus der Sicht des Mannes. Das Grauen dieses Films entfaltet sich so effektiv, da weibliche Ängste als männliche dargestellt werden. Wenn es Ripley in Alien gelingt, das Andere gleich Alien endlich aus ihrem (Über-)Lebensraum zu befördern und ins All zu schießen, erfüllt sich – unabhängig vom Geschlecht – der Wunsch, der Gewalt zu entgehen, der Penetration und Vernichtung.
Eine aktuelle Vertreterin in der Reihe der Siegfriedinnen ist Kate im gleichnamigen eher uninteressanten Film. Er folgt der generischen Vorgabe, sich von der ökonomischen und sexuellen Kontrolle des Souveräns zu emanzipieren. Ästhetisch überwindet Kate (Mary Elizabeth Winstead) ihre Weiblichkeit. Jedoch nur passiv. In einer Szene tauscht sie das symbolisch weiße Kleid gegen eine uniformartige Kleidung und schneidet sich die Haare. Optisch gleicht sie sich der prototypischen Genreheldin Ripley an. Zugleich ist das die Initiation in das wohlgewahrte Geheimnis. Auf gleiche Weise verfährt Luc Besson, wenn er Nikita (Anne Parillaud) stilistisch an Ripley anlehnt. Somit erschafft sich der Mann sein Frauenbild im Genrefilm.
Trivialisierung der Gefühle
Trotz der Versuche Geschlechtergerechtigkeit „zu leben“ und das Richtige zu tun und gut zu finden, fühlen sich viele auf dem angebotenen sprachlichen wie performativen Weg unwohl. Für den Genrefilm steht fest: tendenziell wirkt das generische Maskulinum als Norm fort. Der Genreheld ist männlich, sein weiblicher Gegenpart erscheint nur als eine Facette von Männlichkeit. So haben Genreheldinnen mehr sogenannte männliche Eigenschaften als Genrehelden weibliche. Das Weibliche wird zudem als Spleen markiert, wie die Sache mit dem Hund in John Wick. Der Killer zeigt seine weibliche gleich verletzliche Seite gegenüber einem zur Unterwürfigkeit erzogenen Vierbeiner. Menschen aber tötet er dutzendweise, ohne mit der Wimper zu zucken und um seine Gerechtigkeit zu erhalten. Wir werden zu Zeugen einer merkwürdigen Verschiebung. Wenn man behauptet, das Richtige zu tun, weil es logisch gegen das Falsche gerichtet ist, erteilt sich der Genreheld wie die Genreheldin selbst die Absolution, über Leichen zu gehen.
Im (deutschen) Sprachdiskurs kommen wir, so dämlich das klingt, zu einem vergleichbaren Ergebnis. Die Integration weiterer Geschlechter (als dem zuvor Ausgegrenzten, Gefährlichen, ja Bösen) ändert nichts am Eigentlichen der Sprache. Die sprachliche Markierung verweist immer nur wieder auf das Andere, das außerhalb des Normativen liegt. So bezeichnen Sternchen, Gaps etc. überhaupt erst das Andere statt es in den Sprachgebrauch aufzunehmen. Das Andere bleibt anders, gerade wenn es als ein Gleiches denselben Rang erhalten soll. Mehr als ein Anähneln ist also nicht möglich. Alles andere wäre eine erzwungene Anpassung und so bleibt das Gewohnte normal im konservativen Sinn, um das Enorme, als der Ordnung Widersprechende ausschließen zu können. Auch hier wird das Richtige behauptet, um das Falsche eindeutig zu markieren.
Dieses Eigentliche der Sprache ist die Verwirrung der zugrundeliegenden Ursachen, Motivationen, Ziele, die durch das Medium Sprache kommuniziert werden. Wir wissen, formal sind laut Grundgesetz alle Menschen gleich. Die Sprache wiederum soll das Gesetz abbilden. Aber wir wissen auch, manche Menschen sind gleicher als andere. Die Gleicheren sind da, wo das Geld ist. An den Gleicheren, den bewahrenden also konservativen Kräften liegt es, die Sprachlosen einzuschließen oder eben auszuschließen. Und so obliegt die Aufgabe der Geschlechtergerechtigkeit den altbekannten Wortführerinnen und Wortführern, ob im Uniseminar oder auf der politischen Bühne. Bekanntlich gibt es hier wie dort aber viel heiße Luft und die wird immer dahin gelenkt, wo sie am meisten Wirkung entfaltet: ins Innere der Maschine.
Man braucht nicht in sinnlosen Relativismus verfallen und das Ringen um „korrekte“ Sprache im Westen mit den „wirklichen“ Problemen von Menschen in anderen Ländern vergleichen. Aber, wer um das Sprachliche so kämpft wie um das richtige Handeln gestritten werden sollte, dem ist an der Wahrung des Scheins gelegen. So liegt der Verdacht nahe, dass das politische Ringen um „korrekte“ Sprache zugleich die Vermeidung der Handlung ist. Denn die Debatte bleibt stets abstrakt und den meisten unzugänglich. Was aber vor allem vermieden wird, ist eine inhaltliche Diskussion der Argumente. Inhalte werden immer da vermieden, wo man nichts zu sagen hat, und stattdessen wird die Diskussion auf die Gefühlsebene verlagert. Und da herrscht heute das größere Ego gleich die Rechthaberei und sonst nichts. Paradoxerweise führt diese Verschiebung auf die Gefühlsebene zum Schwund gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es bleibt bei Oberflächlichkeit und Grabenmentalität. Die Folge ist emotionale Abstumpfung – das Gefühl wird trivialisiert. Das juckt weder Konservative noch Radikale, auch die Mitte ist vollkommen zufrieden damit, solange der Machtzuwachs an der sogenannten Basis also der Masse stimmt. Aber wer sich nicht in das gegebene Spektrum einordnen mag, der kann nicht anders als sich unwohl zu fühlen in der eigenen Haut.
Transzendente Weiblichkeit
Auftritt Brunhild. Brunhild ist die Anti-Siegfriedin. Sie, die nicht in einem fairen Duell durch einen Mann bezwungen werden kann, wird doch durch die List zweier Männer der Kontrolle unterworfen, ökonomisch wie sexuell. Sie ist keine herausgeschälte Facette des Mannes wie die Frauen im Genrefilm, sondern ein Eigenes, ein Für-sich als das Weibliche in eigener und übersteigerter Form. Und damit das ebenbürtige Gegenbild zum Übermann Siegfried. Zumindest so lange, bis ihre Macht durch die Vergewaltigung durch Siegfried gebrochen wird.
Lucy (Scarlett Johansson), die Luc Besson im gleichnamigen Film als erste und letzte Frau darstellt, ist mir die einzig bekannte Filmheldin, der eine vollkommene Transzendenz im Genrefilm zugestanden wird. Befähigt durch eine Droge, löst sie sich ins rein Geistige auf. Es ist ein schöner Moment, ab da herrscht endlich Frieden. Die Protagonistin hat alle körperlichen Hüllen abgeworfen und entzieht sich jeglicher männlichen Kontrolle. Sie ist frei, ökonomisch, sexuell, seelisch.
Die Siegfriedin aber ist wie Siegfried bloß eine weitere Chiffre unseres Unglücklichseins in dieser Welt. Solange die reale Ungleichheit fortbesteht, weiden wir uns als Zuschauerinnen und Zuschauer am Kampf, an der Zurschaustellung und Zerstörung des Körpers.