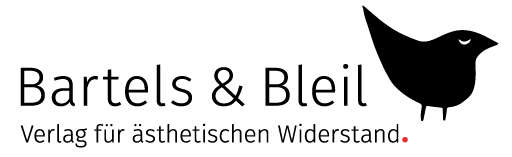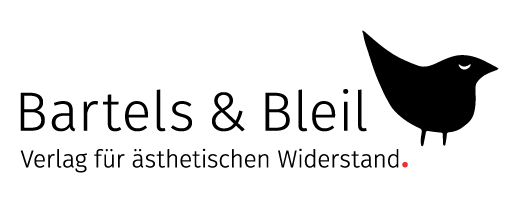Am frühen Morgen des 18. Mai 1887, wenige Tage vor seinem fünfundzwanzigsten Geburtstag, begleitet der angehende Apotheker Andrew Hodkins seinen Freund aus Kindheitstagen, den Dichter, Sozialreformer und notorischen Herumtreiber Drew Barley auf einen Spaziergang. Es ist windig und nasskalt, als sie den verlassen wirkenden Strand von Bunton entlang gehen; feine Wassertröpfchen besprengen ihre Gesichter, und der Wind bläht ihre Mäntel. Die meerzerfressenen Klippen verbergen das Land vor ihnen, und damit auch das dynamische Spiel von Prosperität und Wachstum, das sich dort tagtäglich entfaltet und im schwarzen Qualm der Fabrikschlote seine bildlichste Entsprechung findet. Mit ihm verbunden ist das Versprechen auf Teilhabe und bescheidenen Wohlstand, auf ein besseres Leben, in dem Armut und Elend Erscheinungen einer künftigen Vergangenheit sind, aber auch: Überforderung, Nervosität, Zweifel; jene unvermeidlichen Nebenwirkungen technologischer Beschleunigung und steigender sozialer Komplexität. An diesem Morgen haben die Klippen sie von alldem abgeschnitten: Da ist nur noch die graue Meeresdecke, da sind Sand und Schlick und schmutziger Himmel.
Barley doziert seit geraumer Zeit, er artikuliert eine verzweifelte Hoffnung: Dass sich ein allumfängliches, kosmisches Bewusstsein entwickle, mit dessen Hilfe die etablierte Ordnung gestürzt würde und man zur Urheimat der Seele zurückkehren könne; dem uranfänglichen Reich der Freiheit, ganz wie es in den Büchern Swedenborgs beschrieben stehe. Dann, so Barley, könne die Menschheit ihr müdes Haupt an der Schulter der ewigen Göttin ruhenlassen. Hodkins antwortet ihm nicht gleich; er versteht ohnehin kaum ein Wort von dem, was sein Freund da redet, seit geraumer Zeit ist das schon so: Stattdessen holt er die Flasche Whisky hervor, die er am Vorabend gekauft hat und reicht sie Barley. Er sagt ihm (und die Ironie in seiner Stimme ist unüberhörbar), dass dies die einzige Göttin sei, die er kenne: Ihr Haar sei golden, und um eine tröstende Antwort sei sie nie verlegen. Barley lächelt, doch er hält den Blick gesenkt. Neben ihnen hinterlassen die Wellen schaumige Botschaften im Sand. Schweigend gehen die beiden Freunde nebeneinander her, um sich vom Alkohol und der Brandung die schweren Gedanken aus den Köpfen waschen zu lassen.
Irgendwann sehen sie die Seevögel: Sie kreisen hektisch am Himmel, bilden sonderbare Formationen, die sich sofort wieder auflösen, als würden sie eine Nachricht vermitteln wollen, zusammengesetzt aus einem fremden Alphabet, flüchtig und verschlüsselt. Hodkins und Barley entdecken schnell den Grund für dieses exzentrische Verhalten: Vor ihnen, inmitten eines Tableaus aus Algen und Tang, liegt eine gewaltige fleischige Weichmasse aufgehäuft. Sie ist ganz einfach da, grau und schmierig, ohne Knorpel und ohne Knochen: ein gestrandetes Fabeltier, ein Brocken Ursubstanz, hochgespült aus unbekannten, tiefsten Tiefen. Die Luft um sie herum riecht nach Verwesung, nach Fäulnis und Salz. Barley setzt sich vorsichtig in den feuchten Sand. Still und andächtig betrachtet er die zerfallende Materie, als säße er vor einem Schrein oder den Überbleibseln einer göttlichen Erscheinung. Sein Gesicht zeigt einen Ausdruck völliger Entrückung. Von Hodkins hingegen hat eine dumpfe Beunruhigung Besitz ergriffen: Er verspürt den Impuls zu laufen so schnell er kann, nur widerwillig lässt er sich neben seinem Freund nieder. Er weiß nicht, seit wann die Kopfschmerzen da sind. Er reicht Barley erneut die Flasche: Beide fühlen sich jetzt sturzbetrunken.
Die Möwen über ihnen kreischen wie von Sinnen.
Anmerkungen:
Es ist nie gelungen, zweifelsfrei herauszufinden, um was es sich bei dem sogenannten Hodkins-Barley-Globster tatsächlich handelte: Verschiedene Theorien sprechen vom Kadaver eines Pliosauriers, eines Riesenkalmars oder sogar des mythenumrankten Octopus giganteus; die detaillierten Beschreibungen der Überreste weisen indes eher Merkmale eines Buckelwals auf. Inwieweit der nach ihnen benannte Fund das Leben Andrew Hodkins’ und seines Freundes Barley beeinflusste, ist noch schwieriger zu beantworten: Nach Jahren unaufgeregten Existierens als Apotheker widmete sich Hodkins ab 1901 der Erforschung einer neuartigen Krankheit, die er Morbus Lori nannte (nach seiner Frau Loretta Hodkins). Deren Verlauf schilderte er in einem wissenschaftlichen Journal wie folgt:
Den Betroffenen wächst in nur wenigen Tagen eine nekröse Kruste, die wie eine zweite Hautschicht beinahe den gesamten Körper bedeckt. Sie werden unempfindlich gegen Hitze, Kälte und Berührungen, hinzu kommt die körperliche Entstellung. Diese physischen Symptome gehen einher mit einer geistigen und seelischen Zerrüttung, die unweigerlich zum Suizid führt.
Die Existenz einer solchen Krankheit konnte nie nachgewiesen werden; sie gilt heute als Beispiel pathologischer Wissenschaft. Die Salbe, die Hodkins dagegen entwickelte, erwies sich später jedoch als hilfreich gegen Hautunreinheiten und Wurmbefall. Hodkins reagierte rechtzeitig: Er meldete ein Patent an. 1939 starb er wohlhabend und hochbetagt in seinem Lehnstuhl, als eine seiner Enkeltöchter gerade auf seinem Schoß saß und in einem Bilderbuch blätterte.
Von Barleys Verbleib dagegen ist wenig gesichert: Um 1900 herum erschien er als Straßenverkäufer in Kristiania, brach einige Jahre später von Kopenhagen nach Nepal auf, kehrte als buddhistischer Lama zurück und wurde schließlich nahe der Rennbahn von Deauville gesichtet, wo er den Besuchern getrockneten Kot feilbot, der angeblich von einer Schneekreatur aus den eisigen Höhen des Karakorumgebirges stammte. 1910 beteiligte er sich an der Arktis-Expedition des Briten Edward Hulme, um den Eingang ins Innere der hohlen Erde zu finden. Dann verliert sich seine Spur. Erst 1917 tauchte er wieder vor dem Münchner Rathaus auf: Von der Sonne verbrannt und in nichts weiter gehüllt als einen goldenen Umhang, sang er ausgelassen und tanzte.