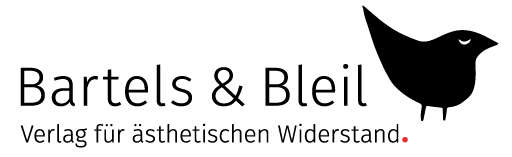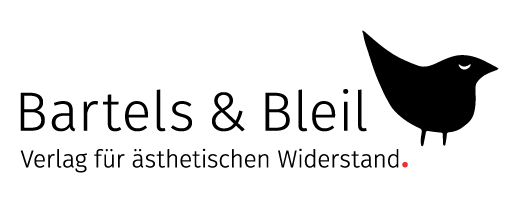Um 1900 herum reist ein Mann, nur von seinem Hund begleitet, mit der Eisenbahn in die badische Provinz. Über einen Mittelsmann hat er hier abseits eines Dorfes ein Stück Land erworben, einen flachen, sanft abfallenden Wiesenhang am Saum eines Waldes. Bei sich trägt er nichts als einen Koffer und in Tuch gehülltes Werkzeug: Schaufel, Harke, Spaten.
Was treibt ihn an?
Der Traum eines Lebens ohne Gott, ohne Vaterland, ohne Kaiser und Könige, ohne Ausbeutung und Elend. Der Traum eines Daseins, das nach den eigenen Fähigkeiten und Vorstellungen gestaltet wird. Der Traum vom neuen Menschen, der befreit von alten Irtümern eine neue Gesellschaft begründet: als erste Zelle einer gemeinschaftlichen, auf Freiheit und Liebe beruhenden Welt.
In der Zukunft, die man gemeinsam errichten würde, verkündet er (in stickigen, von Kerosinlampen nur schwach erleuchteten Dachkammern), seien Geld und Privateigentum abgeschafft: Man arbeite entsprechend seinen Neigungen, könne gleichermaßen Mathematiker sein wie Flussschiffer und Erntehelfer. Arbeitgeber kenne man nur mehr aus den Geschichtsbüchern, eine Regierung, eine Armee, eine Polizei gäbe es nicht mehr. Die Parlamente seien Getreidekontoren oder Lagerstätten für Düngemittel, die Fabriken geschleift und die Gefängnisse niedergebrannt.
Diese neue Gesellschaft, verkündet er (in den Hinterzimmern schummriger, nach altem Fett und Tabakrauch riechender Arbeiterkneipen) sei organisiert in einem Netz lokaler Verwaltungseinheiten, die allesamt autarke Entscheidungen träfen. Hinsichtlich des persönlichen Lebensstils herrsche individuelle Freiheit; in Angelegenheiten, die das Allgemeinwohl beträfen, würden Mehrheitsentscheidungen gefällt. Ergäben sich keine entscheidenden Mehrheiten, würde vertagt, diskutiert, verhandelt und erneut abgestimmt: Für gewöhnlich sähe die Minderheit schließlich ein, dass der Mehrheit ihre Haltung nicht aufgezwungen werden könne.
Die praktische Arbeit gehe immer der geistigen voraus: Ihr Lohn sei die Freude, etwas erschaffen zu haben, sie trüge bei zu Wohlbefinden, Stolz und Zufriedenheit. Dem eigenen Selbstverständnis nach betrachte man sich eher als Schöpfer und Künstler denn als Handwerker und Arbeiter, dennoch seien alle verfertigten Gegenstände Gebrauchsgüter: Ihre Herstellung gründe sich auf langhin gewonnene Einsichten darüber, was benötigt würde und was nicht. Was mit der Hand hergestellt werden könne (und dabei Vergnügen bereite), werde auf solche Weise produziert; das Übrige erledigten Maschinen. Die auf Langlebigkeit hin hergestellten Güter (sowie das Geschick, das über einen langen Zeitraum dabei entwickelt würde), ließen die anfallende Arbeit zunehmend weniger werden, sodass die frei werdende Zeit den Künsten gewidmet werden könne, der Wissenschaft und der Muße.
Mit dem Ende des Privateigentums, verkündet er (in den nach Kohl und Exkrementen stinkenden Innenhöfen der Mietskasernen) verschwänden Egoismus, Habgier und Rücksichtslosigkeit. Das Ende der entfremdeten Arbeit, das Entwickeln und Ausüben ureigener individueller Fähigkeiten, sorge für heiteren Lebensgenuss: Man verlege sich auf das Angenehme und Nützliche, das gemeinhin übereinstimme mit dem Schönen. Es herrsche eine vernunftbasierte Moral, die von höherer Einsicht geprägt sei in die eigenen Affekte: Die Sinnlosigkeit individuellen Fehlverhaltens werde erkannt, von einer Wiederholung abgesehen.
Natürlich, setzt er hinzu, würden die Menschen Hunderte von Jahren alt werden.
Zunächst schläft er unter freiem Himmel. Er badet nackt in Waldbächen, beginnt eine verfallene Schäferhütte wieder zu errichten, harkt den Boden um (Schiefer und Tonerde, schwarz, schwer, von Wetter gesättigt). Die Dorfbevölkerung ist misstrauisch, als er davon berichtet, an dieser Stelle die erste Kolonie einer zukünftigen Menschheit errichten zu wollen. Noch vor Einbruch des Winters erfährt er Unterstützung: Ein Schreiner aus dem Allgäu bleibt die kalten Monate über, man zimmert unter Mühen ein Wohnhaus (die Balken des Gerüsts aus Buchenholz, die Wände aus dem Flechtwerk schmaler Äste, beklebt mit einer Schmiere aus Stroh und Lehm). Den Dachstuhl fertigen sie aus wildem Schilfrohr. Eisiger Novemberregen überzieht das Land, dem tagelange Windböen folgen, Graupelschauer und Schnee. Um ihre schwindenden Vorräte zu schonen ernähren sie sich vom Fleisch der Tiere, die sie heimlich erlegen (Rehkitze und Eichhörnchen, einen Uhu). Aus den abgezogenen Fellen fertigen sie wärmende Kleidung; aus den Knochen eines Fuchses eine Flöte, deren hohler Klang sie selbst um den Schlaf bringt.
Im März schon stößt ein rundes Dutzend weiterer Siedler zur Kolonie, sie bringen den Frühling mit sich und die Zuversicht. Das Leben ist noch immer hart und entbehrungsreich (es fehlt an Nahrungsmitteln und Kleidung, geeignetem Werkzeug oder auch nur der notwendigsten medizinischen Versorgung), dennoch sind rasch Fortschritte zu verzeichnen: Felder werden unter Mühen gepflügt, ein Teich angelegt, Kaninchen beschafft, (dazu Enten und eine Ziege). Man errichtet einen Schuppen und einen Hühnerstall. Bald strömen Neugierige aus den umliegenden Dörfern herbei, um die Troglodyten, wie eine lokale Zeitung sie nennt, zu bewundern.
„Wenn nur ein Mann träumt“, ruft der Mann ihnen zu, „ist es nur ein Traum. Wenn viele Männer denselben Traum träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“
Kein Tag vergeht ohne Mühen und Anstrengungen: Frühmorgens werden die Tiere versorgt, es folgen Feldarbeit, Bauarbeiten und Reparaturen. Die gemeinsamen Mahlzeiten bestehen aus zerstoßenen Linsen und Erbsen, Kräuter (Geflügel und Kaninchen) werden auf den umliegenden Märkten verkauft. Die Unterstützung für die Kolonie wächst beständig: Bald beherbergt man Gäste, es kommen Akademiker, Künstler, Intellektuelle. Man spielt Laientheater, diskutiert, musiziert und tanzt. Abends entzündet man große Freudenfeuer. Bis in den Spätherbst hinein (als nach wochenlangen Regenfällen die Wände zu schimmeln beginnen und sich beißender Qualm im Haus ausbreitet) bleibt die Euphorie ungebrochen. Man zählt inzwischen einundzwanzig feste Bewohner. Die wenige Zeit, die ihnen nach vollbrachtem Tagwerk bleibt, ist der Erschöpfung überlassen und dem Alkohol.
„Wenn die neue Zeit gekommen ist“, singen sie mit roten Gesichtern und glänzenden Augen, „werden die Menschen froh und heiter sein“.
Sie bleiben nicht gefeit von Frust, Missverständnissen und Eifersucht (jener Summe zwischenmenschlicher Konflikte, die unvermeidlich entstehen, wenn sich eine kleine Gruppe über längere Zeit einen begrenzten Raum teilt), dennoch: Das nächste Frühjahr kommt, und mit ihm das erste Kind, das in der Kolonie geboren wird. Alle begreifen sie sich als Mütter und Väter, sie feiern die Geburt mit selbstgemachtem Haferkaffee und Rübenkuchen. Sie bauen ein zweites Haus und ein drittes. Die Ernte entwickelt sich vielversprechend, man hat zwei neue Pflüge günstig auf dem Landmarkt erwerben können. Der Mann aber, der Gründer (den wir als eigentlichen Vater annehmen müssen), wirkt zunehmend unzufrieden: Alles erscheint ihm bereits saturiert und festgefahren, längst fühlt er sich isoliert und nutzlos. Er weiß: Dort draußen, in den Städten des überkommenen Kaiserreichs, kämpfen andere Visionäre echte politische Kämpfe. Er, der so überzeugt davon gewesen ist, dass die beste Form der Revolution das praktische Vorbild ist (die sichtbare Lebbarkeit eines anderen Seinsentwurfs), hadert nun damit, in letzter Konsequenz nur ein Bauer zu sein, der sein Land bestellt (und nicht mehr jener wilde Denker, Anarchist und Agitator, den er immer in sich selbst zu sehen geglaubt hat)
Der Sommer ist kalt und regnerisch, Hagel vernichtet einen Großteil der Ernte. Im Herbst verlassen die ersten Siedler erschöpft und zermürbt, einige von ihnen krank an Körper und Seele, die Kolonie. Verächtlich ruft der Mann ihnen nach, dass ihr Weggang ein Zeichen mangelnder Stärke sei, dass die Kolonie nun gereinigt würde von schwachen Elementen. Im Winter vollzieht er eine entscheidende geistige Wende: An die Stelle der Lehre des praktischen Vorlebens rückt die Überzeugung, dass nur durch die Verbreitung von Wissen (den Vielen durch Aufklärung die Falschheit ihrer Ansichten und ihres Handelns aufzuzeigen) wahre und dauerhafte Veränderung erfolgen könne. Die Revolution, sie habe immer zuerst in den Köpfen stattzufinden. Er träumt nun von Schulen, die er im ganzen Land gründen möchte, von Bibliotheken, einer eigenen Zeitung, Schriften und Manifesten, die zu verbreiten seien, um das Feuer des Aufstands weiter zu schüren, der im Land ja längst im Gange sei. Mithilfe eines Kredits, den ihm Freunde besorgen, beschafft er eine Druckerpresse, gibt bald revolutionäre Pamphlete heraus. Als der Frühling naht und die Felder gepflügt werden müssten und geeggt, kündigt er an, mit dem Fahrrad quer durch das Land reisen zu wollen, um auf den Marktplätzen, Hinterhöfen und Kneipen für die Kolonie zu werben (seine Ideen zu verbreiten und sein Visionen). In den Monaten darauf ist er glücklich wie lange nicht: Er disputiert wieder, agitiert, verdammt Monarchie und Großkapital, preist seine Kolonie als einen Hort des Widerstands (eine Zuflucht für die Verfolgten, Verdammten und Verworfenen).
Als er zurückkehrt ist er euphorisiert und voller Tatendrang, doch in seiner Abwesenheit hat die Kolonie sich verändert: Neue Bewohner haben die zuletzt licht gewordenen Reihen aufgefüllt, deren Ideal nicht jenes einer neuen Gesellschaft zu sein scheint (in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ihr Ende gefunden hat), sondern eine Hinwendung zum Wissen um andere Wirklichkeiten. Einige hängen der Gymnosophie an, der Theosophie oder anderen eklektischen Theorien von der menschlichen Entwicklung hin zu spiritueller Vollkommnung. Einer behauptet, dass die jüdisch-christliche Zivilisation die wahren germanischen Tugenden unterdrücke; eine andere predigt einen ursprünglichen Zustand sexueller Ungebundenheit, den Triumph des Eros, der Entgrenzung und kosmische Ekstase bedeute. Lichtesser liegen auf den Wiesen, nackte Sonnenkinder tanzen ihre Reigen. Eines Abends jagt der Mann sie davon wie Jesus die Wucherer aus dem Tempel: Da er selbst dieses Stück Land einst günstig erworben hat, droht er damit, die Polizei rufen zu lassen, um die Propheten des Irrationalismus, wie er sie verächtlich nennt, von seinem Grund und Boden zu vertreiben.
Dies alles, brüllt er, sei sein Eigentum.
Um seinen Kolonisten die fehlgeleiteten Fantasien von Erleuchtung und Erlösung auszuwaschen, stellt er im Winter ein strenges Regelwerk auf: Man lebt fortan sexuell enthaltsam, isst vegetarisch, trinkt keinen Alkohol und raucht keinen Tabak. An die Stelle heiterer Abendgeselligkeiten sind lange Sitzungen getreten, in denen der Mann aus den Schriften von Fourier und Rousseau, Marx und William Morris liest (die wenigen Aktiven, zitiert er und blickt dabei in trübe Gesichter, würden immer die Masse beeinflussen). Häufig zieht er sich nun mit seinem Hund in die Einsamkeit der nahen Wälder zurück, um nachzudenken. Schon im kommenden Frühjahr möchte er erneut losziehen mit seinem Fahrrad; möchte Unterstützer finden und mögliche Geldgeber für seinen Plan, fahrende Universitäten zu gründen, die unaufhörlich durch ganz Europa reisen sollen.
Eines Abends, noch bevor der Schnee schmilzt (als der Tag vielleicht ein wenig mühsamer verlaufen war und freudloser als die vorigen), überwirft er sich mit der Mutter seines Kindes, die längst gefährdet sieht, was man gemeinsam geschaffen hat: Das Glück, brüllt sie ihm verzweifelt entgegen, läge doch hier (wie er das nicht sehen könne); bei seinem Sohn und ihr und den Menschen, denen sie nahe seien und mit denen sie sich doch (jetzt und gerade) gemeinsam ein Leben aufbauen würden. Seine ideale Welt dagegen werde es niemals geben, und überhaupt ginge es ihm darum doch schon lange nicht mehr, sondern einzig und allein um sich selbst. Der Mann ohrfeigt sie, stößt sie zu Boden. Spätestens in diesem Moment ist auch sie ihm zum Hindernis geworden: Sie teilen nicht mehr denselben Traum. Er verlässt die Kolonie überstürzt, nur der Hund folgt ihm hinaus in den Schnee. In einem Wirtshaus betrinkt er sich bis zur Besinnungslosigkeit. Einige Monate später verhaftet man ihn wegen Anstiftung zum öffentlichen Aufruhr. Er wird zu mehreren Jahren Festungshaft verurteilt.
An einem windigen Herbsttag kehrt er zurück, allein, nur mit einem Bündel versehen und einem schweren Revolver in der Tasche. Er hat im Gefängnis nur Gerüchte gehört: Die Kolonie sei inzwischen zur Räuberhöhle geworden und zum Bordell. Seine Frau und das Kind sind längst nach München zurückgekehrt. Als er oberhalb des Hangs anlangt (fünf Jahre, nachdem er dort zum ersten Mal unter offenem Himmel geschlafen hat) ist niemand mehr zu sehen. Die Felder sind verwachsen, die Stallungen verwüstet. Die Häuser zerfallen bereits zu Ruinen.
Der Mann braucht nicht lange, um eine Entscheidung zu fällen: Noch am selben Abend brennt er alles nieder. Er starrt bis zum Morgengrauen in die Flammen und den leeren Nachthimmel über ihm, begreift sein Scheitern und die Freiheit, die darin liegt. Am nächsten Morgen wandert er in das nächstgelegene Dorf. Er besorgt sich eine Harke, eine Schaufel und einen Spaten.
Dann beginnt er von vorn.